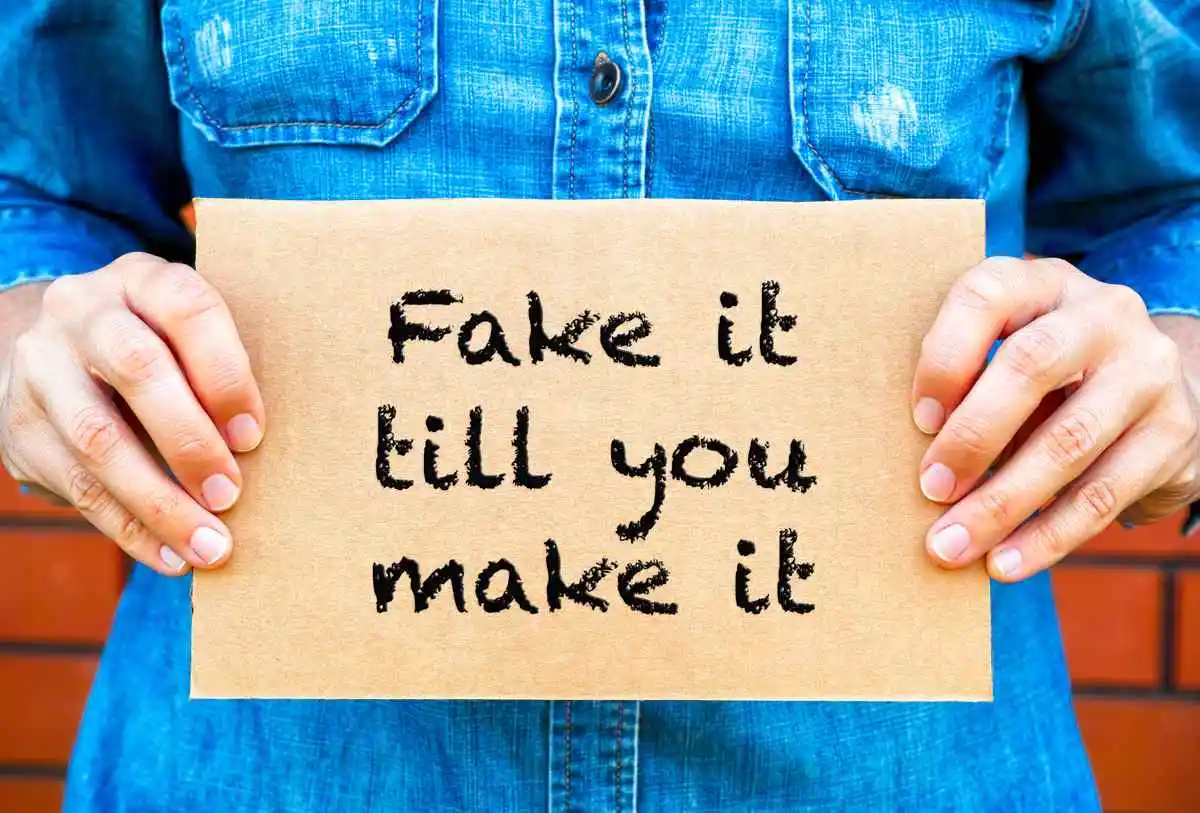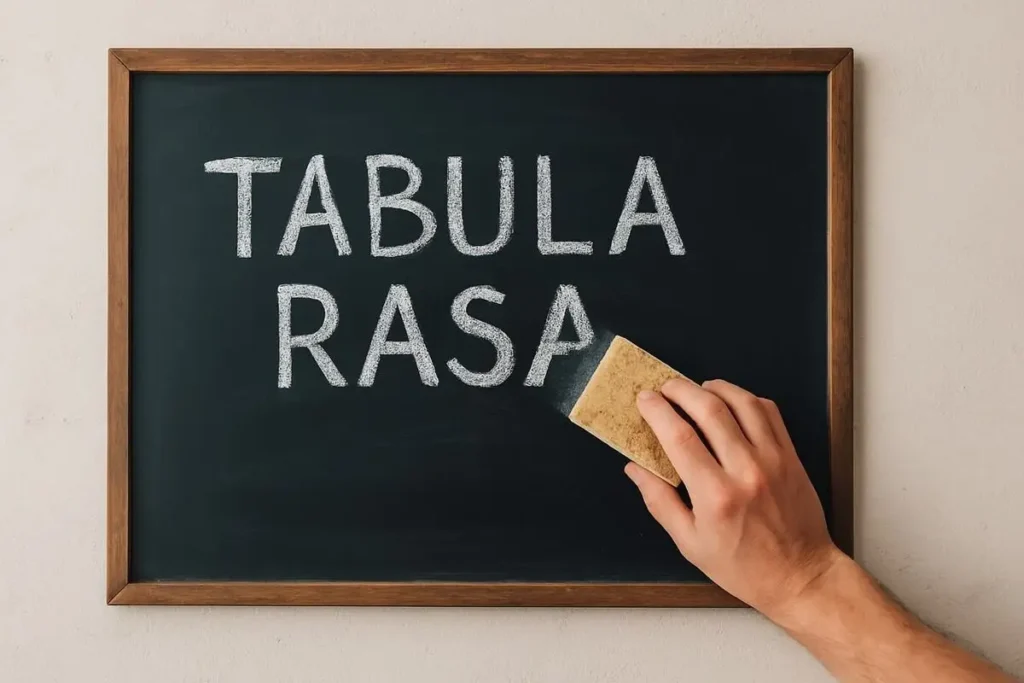„Fake it till you make it“ – dieser Satz klingt nach Mut, Selbstvertrauen und einem Augenzwinkern. Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen neuen Job, fühlen sich unsicher, lächeln souverän und handeln, als hätten Sie alles im Griff. Genau hier entfaltet die Redewendung ihre Kraft: Sie beschreibt das Prinzip, so zu tun, als sei man bereits erfolgreich, bis man es tatsächlich ist – nicht als Täuschung, sondern als Einladung, Haltung zu zeigen und Schritt für Schritt hineinzuwachsen.
In Deutschland ist „Fake it till you make it“ längst Teil des modernen Sprachgebrauchs. In einer Zeit, in der Selbstvermarktung und Auftreten dominieren, trifft sie einen Nerv. Doch woher stammt der Ausdruck, und was steckt dahinter? Warum sagen wir lieber „Fake it till you make it“ statt eines deutschen Pendants?
Im Beitrag erhalten Sie: die Bedeutung in einfacher Sprache, den Ursprung, den sprachlichen Hintergrund sowie Beispiele für den richtigen Einsatz – inklusive, wann Zurückhaltung klüger ist.
Hinweis der Redaktion: Entdecken Sie hier alle unsere vorgestellten Redewendungen!
Bedeutung von „Fake it till you make it“ im Deutschen
Die Redewendung „Fake it till you make it“ lässt sich wörtlich mit „Tu so, als hättest du es schon geschafft, bis du es wirklich geschafft hast“ übersetzen. Sie beschreibt die Idee, Selbstvertrauen, Kompetenz oder Erfolg vorzugeben, um diese Eigenschaften im Laufe der Zeit tatsächlich zu entwickeln. Im Kern steht das Prinzip, durch eine selbstbewusste Haltung und positives Auftreten echte Fortschritte zu erzielen.
„Fake it till you make it“ bedeutet, dass Schein und Sein zeitweise ineinandergreifen: Wer sich verhält, als wäre er bereits souverän oder erfolgreich, stärkt mit dieser Haltung seine innere Überzeugung. Es geht nicht um Täuschung, sondern um eine Form mentaler Selbstermächtigung.
Im Deutschen wird die Redewendung meist im Sinne von „Glaube an dich, auch wenn du noch nicht so weit bist“ verstanden. Sie spiegelt ein kulturelles Spannungsfeld zwischen Authentizität und Inszenierung wider. Während das Englische stärker den motivierenden Charakter betont, wird im Deutschen häufiger hinterfragt, ob das „Vortäuschen“ moralisch vertretbar ist.
Bildlich lässt sich das Konzept mit einem Schauspiel vergleichen: Man spielt eine Rolle, bis sie Teil der eigenen Realität wird. Die Bühne steht dabei für das Leben, auf dem Auftreten und Entwicklung untrennbar verbunden sind.
Diese Wendung verbindet Sprache, Psychologie und Kultur – sie zeigt, wie Überzeugung und Verhalten ineinandergreifen und Selbstvertrauen wachsen lassen können.
„Fake it till you make it“: Herkunft, Ursprung und sprachlicher Hintergrund
Die Redewendung „Fake it till you make it“ entstand im 20. Jahrhundert im englischsprachigen Raum, vermutlich in den Vereinigten Staaten. Ihre Wurzeln liegen in der Verbindung von Psychologie, Philosophie und Motivationsliteratur – einer Epoche, in der Selbstverwirklichung, Aufstiegsideale und die Macht der Haltung zunehmend in den Fokus rückten.
Der Gedanke, dass Verhalten innere Überzeugungen formen kann, findet sich schon in der Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts. Der Philosoph Hans Vaihinger beschrieb in Die Philosophie des Als Ob (1911), dass Menschen mit bewussten Fiktionen leben und handeln, als wären sie real – um Orientierung, Motivation und Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Aufbauend auf diesem Ansatz entwickelte Alfred Adler in seiner Individualpsychologie das Konzept des fiktionalen Finalismus: Der Mensch richtet sein Verhalten an idealen Vorstellungen aus, die er noch nicht erreicht hat, handelt also „als ob“ sie bereits Wirklichkeit wären. So kann aus gespielter Sicherheit echte Stärke entstehen.
In den 1960er-Jahren wurde „Fake it till you make it“ in den USA durch Selbsthilfe- und Motivationstrainer populär, die betonten, dass Auftreten und Denken persönliche Entwicklung beschleunigen können. In den 1970er-Jahren fand die Redewendung Eingang in die Gemeinschaft der Alcoholics Anonymous, wo sie dazu diente, Teilnehmer zu ermutigen, ein neues Verhalten so lange zu praktizieren, bis es zur Überzeugung wurde.
Heute gilt „Fake it till you make it“ als prägnante Formel moderner Selbstwirksamkeit – inspiriert von philosophischen Ideen, psychologischer Forschung und kulturellem Aufstiegsdenken. Sie bringt auf den Punkt, dass Handeln oft der erste Schritt zu innerer Veränderung ist.
Anwendung von „Fake it till you make it“ im Alltag mit konkreten Beispielen
Die Redewendung „Fake it till you make it“ zeigt ihre Wirkung besonders im Alltag – dort, wo Unsicherheit auf neue Herausforderungen trifft. Sie beschreibt den Moment, in dem Haltung und Handeln vorausgehen, um innere Stärke entstehen zu lassen. Ob im Beruf, in sozialen Situationen oder im persönlichen Wachstum: Der Satz ist ein Werkzeug, das Mut, Selbstvertrauen und Perspektive fördert.
Typische Lebensbereiche, in denen die Redewendung greift, sind vielfältig:
- Beruflicher Einstieg: Wer einen neuen Job beginnt, fühlt sich oft überfordert. Sich dennoch souverän zu geben, stärkt das Vertrauen anderer – und bald auch das eigene. Ein ruhiger Ton, ein fester Blickkontakt und vorbereitete Argumente wirken glaubwürdiger, als man sich zunächst fühlt.
- Öffentliche Auftritte: Viele Menschen fürchten Präsentationen oder Reden. Wer freundlich auftritt, klar spricht und bewusst Haltung zeigt, verankert schrittweise echtes Selbstbewusstsein. Das „Tun als ob“ wird zur Brücke zwischen Nervosität und Kompetenz.
- Soziale Kontakte: In neuen Gruppen wirkt Zurückhaltung schnell wie Unsicherheit. Ein offenes Lächeln, Interesse und authentische Körpersprache helfen, Anschluss zu finden – auch wenn man sich innerlich unsicher fühlt.
- Sport und Training: Im Wettkampf oder beim Lernen neuer Fähigkeiten hilft die innere Haltung: Wer sich selbst als fähig ansieht, bleibt motiviert und erreicht schneller echte Fortschritte.
- Persönliche Entwicklung: In Krisenphasen oder Neuanfängen kann es helfen, sich an das gewünschte Ich heranzutasten. Der erste Schritt ist oft ein gespielter – doch wer konsequent handelt, formt daraus echte Veränderung.
„Fake it till you make it“ bedeutet nicht, sich zu verstellen, sondern das zukünftige Selbst aktiv vorzubereiten. Der Ausdruck erinnert daran, dass Auftreten, Denken und Entwicklung ineinandergreifen – und dass innere Stärke oft dort beginnt, wo man sie mutig spielt, bis sie real geworden ist.
Vergleichbare deutsche Redewendungen
Viele deutsche Redewendungen kommen der Bedeutung von „Fake it till you make it“ nahe, doch keine erfasst den gesamten Gedanken: den bewussten Übergang von gespielter Sicherheit zu echter Souveränität. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich Sprache Selbstbewusstsein, Wirkung und Entwicklung beschreibt – und warum die englische Formel oft bevorzugt wird.
- „Kleider machen Leute“: Diese bekannte Redewendung hebt hervor, dass äußeres Auftreten Wahrnehmung und Erfolg stark beeinflusst. Sie spiegelt die Idee wider, dass Erscheinung Türen öffnen kann, noch bevor Kompetenz sichtbar ist. Anders als „Fake it till you make it“ zielt sie jedoch allein auf das Äußere ab, nicht auf inneres Wachstum oder langfristige Veränderung. Das Selbstbild bleibt unverändert – es geht mehr um Wirkung als um Entwicklung.
- „Den Schein wahren“: Hier steht die Aufrechterhaltung eines positiven Bildes im Vordergrund. Menschen wahren den Schein, um Stabilität zu zeigen, selbst wenn Unsicherheit besteht. Der Ausdruck hat oft eine defensive Färbung und klingt nach Pflicht statt nach Selbstentfaltung. „Fake it till you make it“ wirkt dagegen aktiver: Es beschreibt nicht das Verbergen, sondern das bewusste Arbeiten an einer besseren Version des eigenen Ichs.
- „In eine Rolle schlüpfen“ / „eine Rolle spielen“: Diese Formulierung beschreibt das Einnehmen eines bestimmten Verhaltensmusters. Im beruflichen oder sozialen Kontext kann sie hilfreich sein, um Erwartungen zu erfüllen. Doch während die deutsche Variante die Distanz zwischen Rolle und Realität betont, überwindet die englische Wendung genau diese Grenze – sie führt vom Spiel zur Echtheit.
- „Sich nichts anmerken lassen“: Diese Redewendung bedeutet, innere Zweifel zu verbergen und nach außen Stärke zu zeigen. Sie vermittelt Selbstkontrolle, aber keinen Wandel. „Fake it till you make it“ geht weiter: Es beschreibt, wie man Unsicherheit in Motivation umwandelt und an sich selbst wächst.
- „Gutes Gesicht zum bösen Spiel machen“: Dieser Ausdruck steht für Haltung in schwierigen Zeiten. Er vermittelt Standhaftigkeit und Fassung, aber keinen Fortschritt. Die englische Variante dagegen betont Weiterentwicklung – sie ermutigt, aus schwierigen Situationen echte Stärke zu formen.
Insgesamt zeigt sich: Deutsche Redewendungen beleuchten einzelne Aspekte von Selbstbeherrschung, Auftreten oder Wirkung. Doch „Fake it till you make it“ vereint all das in einem Satz – modern, prägnant und mit einer positiven Perspektive auf Veränderung.
Beliebtheit und Relevanz der Redewendung heute
Die Formulierung „Fake it till you make it“ bleibt aktuell, weil sie ein Zeitgefühl verdichtet: Wirkung kann Entwicklung anstoßen – und knappe, einprägsame Sprache passt perfekt zu digitalen Medien. Kultur und Pop bringen den Ausdruck immer wieder ins Gespräch und halten ihn damit sichtbar.
Typische kulturelle Bezugspunkte zeigen die Breite der Verbreitung:
- Musik – Klassiker & Gegenwart: Simon & Garfunkels „Fakin’ It“ (1968) spielt mit der Wortnähe („I’m fakin’ it, I’m not really makin’ it“) und verankert das Motiv früh im Popkanon. Aktuell greift Taylor Swift die Wendung wörtlich in „I Can Do It With a Broken Heart“ auf („you gotta fake it ’til you make it“).
- Serien & Episodentitel: Das Prinzip wird selbst zum Titel, etwa bei Blue Bloods: „Fake It’ Till You Make It“ (2023) – ein Hinweis darauf, wie selbstverständlich die Formel im seriellen Erzählen geworden ist.
- Film-Dialoge: In Boy Erased fällt der Satz explizit („Fake it till you make it“) – die Redewendung wird als klare Handlungsanweisung eingesetzt.
- Internationale Produktionen: Der gleichnamige chinesische Drama-Titel Fake It Till You Make It (2023) zeigt, dass die Formel global verständlich und markant genug für einen Serientitel ist.
Warum bleibt der Ausdruck im 21. Jahrhundert populär? Er klingt modern, ist leicht zitierbar, passt in Überschriften, Memes und Hashtags und verbindet Aufbruchsstimmung mit Lernpfad – ein Mix, der in Musik, Serien und Online-Kultur schnell Anschluss findet.
Kurz gesagt: Kultur und Medien recyceln und erneuern „Fake it till you make it“ fortlaufend; dadurch bleibt der Satz präsent, verständlich und stilistisch anschlussfähig – von Songs über Episodentitel bis zu internationalen Serien.
„Fake it till you make it“ – souverän wirken, bis es gelingt
„Fake it till you make it“ beschreibt die Fähigkeit, Selbstsicherheit vorzuleben, bis sie selbstverständlich geworden ist. Die Redewendung steht für den Mut, Haltung zu zeigen, klar zu sprechen und Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man sich innerlich noch unsicher fühlt. Sie verbindet Auftreten mit Entwicklung – aus anfänglichem Tun entsteht echtes Können. Wertvoll ist dieser Ansatz, weil er Menschen ermutigt, über sich hinauszuwachsen und neue Aufgaben mit Zuversicht anzugehen.
Problematisch wird er, wenn bloß Fassade bleibt oder Kompetenz vorgetäuscht wird. Setzen Sie die Redewendung gezielt ein, wenn Selbstvertrauen den ersten Schritt ebnet: bei Vorträgen, Bewerbungsgesprächen oder neuen Rollen. Vermeiden Sie sie, wenn Offenheit, Authentizität oder Vertrauen gefährdet wären. „Fake it till you make it“ entfaltet seine Wirkung dort, wo Haltung und Lernen gemeinsam wirken – als Brücke vom Vorsatz zur echten Stärke.
Reflektieren Sie: Wo hilft Ihnen „Fake it till you make it“, zu wachsen – und wann wäre ehrliche Selbstsicht der bessere Weg?
Häufige Fragen (FAQ) zur Redewendung „Fake it till you make it“
„Fake it till you make it“ bedeutet, selbstbewusstes, professionelles Verhalten vorzuleben, bevor es vollständig verinnerlicht ist. Gemeint ist keine Täuschung, sondern eine Übergangsstrategie: Haltung zeigen, klar sprechen, Verantwortung übernehmen und das sofort mit Lernen, Übung und überprüfbaren Ergebnissen verbinden. So nähert sich die äußere Wirkung der inneren Realität schrittweise an. Wichtig ist, Grenzen zu kennen und transparent zu bleiben, damit Vertrauen wächst und aus anfänglicher Rolle belastbare Kompetenz entsteht. Dieser Ansatz bleibt zeitlich begrenzt.
Die Wendung „Fake it till you make it“ stammt aus dem englischsprachigen 20. Jahrhundert und verknüpft Aufstiegsdenken mit Selbsthilfe- und Motivationsliteratur. Früh wurde die Idee populär, dass Auftreten Verhalten prägt und Verhalten Entwicklung beschleunigt. Über Ratgeber, Medien und Popkultur gelangte sie seit den 1990er-Jahren in den deutschen Sprachgebrauch. Ihre knappe, merkfähige Struktur, internationale Verständlichkeit und ständige Zirkulation in Musik, Serien und Social Media hielten sie präsent und machten sie zu einer geläufigen Alltagsphrase.
„Fake it till you make it“ spricht man ungefähr „feik it til ju meek it“. Wichtig sind das klare Diphthong „ei“ in „fake“, das weiche „j“ in „you“ und die leichte Betonung auf „fake“, „till“ und „make“. Sprechen Sie zunächst langsam, halten Sie kurze Pausen zwischen den Sinngruppen und steigern Sie das Tempo, sobald die Folge sicher sitzt. Ziel ist eine ruhige, verständliche Aussprache, die souverän klingt, ohne künstlich akzentfrei zu wirken.
Setzen Sie „Fake it till you make it“ ein, wenn Auftreten eine Brücke zum Lernen bildet und Sie den Vorsprung sofort mit Vorbereitung, Übung und überprüfbaren Ergebnissen füllen. Geeignet sind Auftritte, Gespräche, Prüfungen und neue Rollen, sofern Transparenz gewahrt bleibt. Verzichten Sie darauf, wenn Kompetenzen nur vorgetäuscht, Risiken kaschiert oder Vertrauen gefährdet würden. In solchen Fällen sind klare Grenzen, ehrliche Kommunikation, Mentoring und Training die bessere Wahl, damit Glaubwürdigkeit und Sicherheit parallel wachsen.
Als deutsche Alternativen werden häufig „Kleider machen Leute“, „in eine Rolle schlüpfen“, „sich nichts anmerken lassen“ und „den Schein wahren“ genannt. Jede Formel trifft nur einen Ausschnitt: äußere Wirkung, performatives Verhalten, Signalkontrolle oder Bewahrung eines Eindrucks. „Fake it till you make it“ bündelt dagegen Haltung plus Lernweg in einer prägnanten Zeile und beschreibt den Übergang von geliehener Souveränität zu echter Kompetenz. Deshalb bevorzugen viele die englische Fassung in Beratung, Ausbildung und Medien.
Ethisch vertretbar ist „Fake it till you make it“, wenn es eine kurze Brücke bleibt und sofort in Qualifizierung, Übung und messbare Resultate mündet. Kritisch wird es, sobald Schein Substanz ersetzt, Risiken verdeckt oder Verantwortlichkeiten verwischt werden. Dann drohen Vertrauensverlust und Fehlentscheidungen. Verantwortlich handeln bedeutet: Grenzen kennen, Feedback suchen, transparent kommunizieren und Fortschritt belegen. So entsteht aus anfänglicher Rolle echte Kompetenz, ohne Integrität, Sicherheit oder Qualität in sensiblen Umgebungen zu gefährden.
„Fake it till you make it“ beschreibt eine Methode, Selbstvertrauen zu erzeugen, bevor es natürlich vorhanden ist. Beim bewussten Aufbau von Selbstvertrauen wachsen innere Sicherheit und äußeres Auftreten gleichzeitig. Die Redewendung setzt dagegen auf proaktives Handeln: Sie verlagert den Fokus auf sichtbares Verhalten, das nach und nach die innere Überzeugung stärkt. Entscheidend ist, dass der äußere Eindruck nicht zum Dauerersatz wird, sondern zum Motor für echtes Wachstum und authentische Kompetenz dient.
„Fake it till you make it“ wirkt motivierend, weil es Menschen erlaubt, sich bereits als fähig zu sehen, bevor der endgültige Erfolg da ist. Das stärkt Handlungsbereitschaft und Zuversicht. Psychologisch basiert der Ansatz auf dem sogenannten „Selbstwirksamkeitseffekt“: Wer sich in einer Rolle erlebt, übernimmt deren Eigenschaften schneller. So kann das Prinzip Fortschritte beschleunigen. Wichtig ist, Ehrlichkeit zu bewahren und die Motivation durch messbare Erfolge und Feedback abzusichern, um langfristig glaubwürdig zu bleiben.
Im beruflichen Kontext kann „Fake it till you make it“ hilfreich sein, wenn es als Lernstrategie verstanden wird. Wer souverän auftritt, signalisiert Kompetenz und schafft Vertrauen. Entscheidend ist, das gezeigte Verhalten schnell mit Wissen, Vorbereitung und Ergebnissen zu füllen. In Bewerbungsgesprächen oder Führungsrollen kann dies Türen öffnen, sofern Authentizität und Verantwortung erhalten bleiben. Wird es jedoch zur Maske ohne Substanz, wirkt es manipulativ und verliert jede positive Wirkung im beruflichen Umfeld.
Ja, die Idee von „Fake it till you make it“ stützt sich auf psychologische Konzepte wie die „Selbsterfüllende Prophezeiung“ und die „Cognitive Dissonance Theory“. Beide besagen, dass Verhalten Gedanken beeinflussen kann. Wer sich selbstbewusst verhält, obwohl Unsicherheit besteht, passt langfristig seine innere Haltung an die äußere Darstellung an. So entsteht ein echter Veränderungsprozess. Dieser Effekt ist wissenschaftlich belegt, etwa in Experimenten zur Körperhaltung und zum Einfluss positiver Selbstwahrnehmung auf Verhalten und Emotionen.
Im privaten Bereich kann „Fake it till you make it“ zu Missverständnissen führen, wenn gezeigtes Verhalten nicht mit innerer Überzeugung übereinstimmt. Freunde oder Partner empfinden es dann als unauthentisch. Der Ansatz birgt außerdem die Gefahr, Druck aufzubauen, weil man sich ständig stärker präsentieren möchte, als man sich fühlt. Wichtig ist daher, Balance zu halten: kurzzeitig Mut zeigen, langfristig ehrlich bleiben. Nur so bleibt Selbstentwicklung glaubwürdig und Beziehungen stabil und vertrauensvoll.
Ja, wenn „Fake it till you make it“ dauerhaft praktiziert wird, kann es psychisch belasten. Ständige Selbstdarstellung erzeugt Stress und Entfremdung vom eigenen Empfinden. Menschen riskieren, innere Unsicherheiten zu überdecken, statt sie zu bearbeiten. Richtig angewandt kann der Ansatz jedoch stärken, weil er kleine Erfolgserlebnisse erzeugt und Selbstvertrauen fördert. Entscheidend ist, Pausen, Reflexion und emotionale Ehrlichkeit einzuplanen, damit Selbstinszenierung kein Ersatz, sondern ein Weg zu echter Stabilität bleibt.
Nachhaltig gelingt „Fake it till you make it“, wenn äußeres Auftreten mit innerem Lernen verknüpft wird. Wer Neues ausprobiert, sollte bewusst Feedback suchen und Erfolge dokumentieren. Kleine, realistische Schritte helfen, Fortschritt sichtbar zu machen. Selbstreflexion und Authentizität sichern, dass die Strategie kein Rollenspiel bleibt, sondern zur echten Entwicklung führt. So entsteht eine stabile Balance zwischen Selbstpräsentation und persönlichem Wachstum – ohne Druck, sondern mit realem Vertrauen in die eigene Fähigkeit.
Mehr internationale Redewendungen
Wenn Sie weitere internationale Redewendung wie „Fake it till you make it“ suchen, finden Sie nachfolgend eine Auswahl von Redensarten, die im Deutschen häufiger genutzt werden:
- Carpe diem
- Carte blanche
- C’est la vie
- Hakuna Matata
- Keep it simple
- La dolce vita
- Mamma mia
- Mea culpa
- Memento mori
- No risk, no fun
- Out of the box
- Persona non grata
- Tabula rasa
- The show must go on
- Veni, vidi, vici
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
_______________________________________
Cover-Bild: © rosinka79 | stock.adobe.com